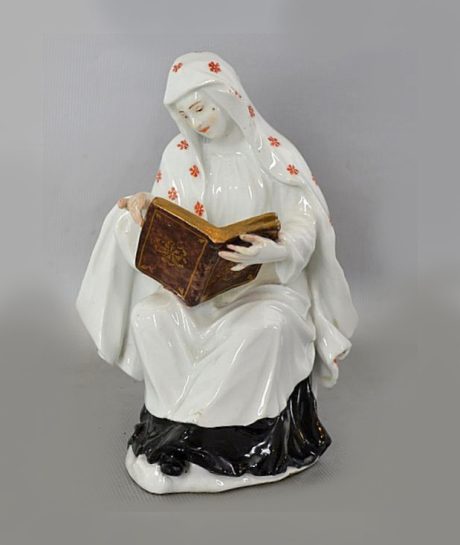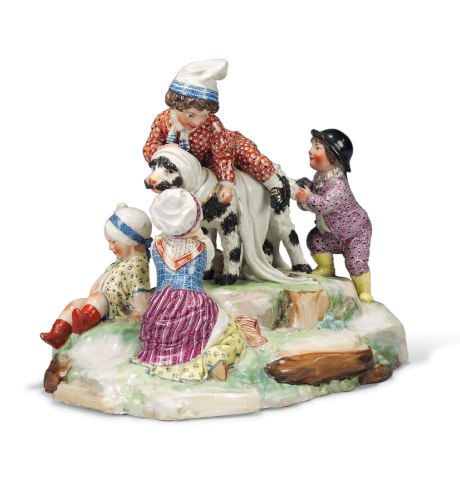GALERIE Porzellan-Fayencen
Hier finden Sie eine Auswahl der von uns angebotenen Porzellane sowie Fayencen.
Gerne senden wir Ihnen weitere Fotos zu.
Ebenso stehen wir für zusätzliche Auskünfte gerne zur Verfügung.
 JUNGES MÄDCHEN MIT TAMBURIN Zürich, um 1785. Porzellan Mit der rechten Hand auf das mit Glöckchen versehene Instrument schlagend, auf einem runden Felssockel stehend. Pressmarken K . 4. I H 16 cm. Vgl. S. Ducret, Die Zürcher Porzellanmanufaktur, 19
JUNGES MÄDCHEN MIT TAMBURIN Zürich, um 1785. Porzellan Mit der rechten Hand auf das mit Glöckchen versehene Instrument schlagend, auf einem runden Felssockel stehend. Pressmarken K . 4. I H 16 cm. Vgl. S. Ducret, Die Zürcher Porzellanmanufaktur, 19
JUNGES MÄDCHEN MIT TAMBURIN
Zürich, um 1785.
Porzellan
Mit der rechten Hand auf das mit Glöckchen versehene Instrument schlagend, auf einem runden Felssockel stehend.
Pressmarken K . 4. I
H 16 cm.
Vgl. S. Ducret, Die Zürcher Porzellanmanufaktur, 1958, Vol. II, Abb. 439 (Gabriel Klein zugeschrieben); Rudolf Schnyder, Sammlung Dr. E.S. Kern, KFS Mitteilungsblätter
Nr. 122, 2009, S. 62 (um 1775, Hans Jakob Spengler?).
Inv.-Nr. 0.403
1.450 €
Bologneser Hund Männchen machend
Meißen um 1750
Porzellan
Modell Johann Joachim Kaendler (1740-1748).
Höhe 25,5 cm
Der Bologneser Hund, der bereits im 11. und 12. Jahrhundert wegen seiner Anmut sehr geschätzt wurde, stieg im 16. Jahrhundert unter König Heinrich III. von Frankreich zum beliebtesten Schoßhund ("Bichon") der aristokratischen Gesellschaft auf und galt in den herrschenden Kreisen als wertvolles Geschenk. Auch große Namen des 18. Jahrhunderts, darunter die Marquise de Pompadour, Katharina II. von Russland oder Maria Theresia von Österreich, werden mit dem Hund aus Bologna in Verbindung gebracht. Vor allem der sächsische Kurfürst Friedrich August II. soll von den als intelligent und temperamentvoll geltenden Tieren sehr angetan gewesen sein und Kaendler gebeten haben, mehrere Modelle aus Porzellan zu entwerfen. Hierbei handelt es sich um zwei Gegenstücke, wie Kaendler in seiner Taxa von 1740-1748 angibt: "2. Hunde aus Polognes oder Zottligte, sich gegenseitig auf Camine zu sezen anschauend, wovon der eine sich krazet, der andere jedoch auffrecht sizet, pro 1. Stück 4. Thlr. Der äußerst realistisch dargestellte kleine Hund aus Bologna überzeugt durch seine eingefrorene Haltung mitten in der Bewegung, die naturalistische Wiedergabe seines Fells sowie durch seine ausdrucksstarke Mimik.
Literatur :
Sponsel, J.L.: Kabinettstücke der Meissner Porzellan-Manufaktur von Johann Joachim Kändler, Leipzig, 1900, S. 92ff, S. 229.
Albiker, C: Die Meissner Porzellanmanufakturen im 18. Jahrhundert, Berlin, 1959, Abbildung 186.
Menzhausen, I. und Karpinski, J.: In Porzellan verzaubert - Die Figuren Johann Joachim Kaendlers in Meißen aus der Sammlung Pauls-Eisenbeiss Basel, S. 200.
Inv.-Nr. 0.302
950 €
 Schäfergruppe Ludwigsburg Porzellan Modell Johann Christoph Haselmeyer zugeschrieben um 1770 H. 16,6 cm Blaue Marke doppeltes ligiertes C, Pressnummer 25, eingeritztes Quadrat. Vgl.: Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart 1997, Nr. 68, S. 253 und
Schäfergruppe Ludwigsburg Porzellan Modell Johann Christoph Haselmeyer zugeschrieben um 1770 H. 16,6 cm Blaue Marke doppeltes ligiertes C, Pressnummer 25, eingeritztes Quadrat. Vgl.: Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart 1997, Nr. 68, S. 253 und
Schäfergruppe
Ludwigsburg
Porzellan
Modell Johann Christoph Haselmeyer
zugeschrieben
um 1770
H. 16,6 cm
Blaue Marke doppeltes ligiertes C, Pressnummer 25, eingeritztes Quadrat.
Sehr guter Erhalutungszustand.
Vgl.:
Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart 1997, Nr. 68, S. 253 und 510;
Brattig (Hg), Glanz des Rokoko, Ludwigsburger Porzellan aus der Sammlung Jansen, Stuttgart 2008, Nr. 27, S. 104 f.
Inv.Nr.0.525
1.500 €
 Vase Russian Imperial Porcelain Factory Porzellan Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg Alexander I. Um 1820 H. 97 cm (!!!) Trompe-l’œil – Malerei Malachit
Vase Russian Imperial Porcelain Factory Porzellan Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg Alexander I. Um 1820 H. 97 cm (!!!) Trompe-l’œil – Malerei Malachit
Vase
Russian Imperial Porcelain Factory
Porzellan
Rußland
Kaiserliche Porzellanmanufaktur
St. Petersburg
Alexander I.
Um 1820
H. 97 cm (!!!)
Trompe-l’œil – Malerei Malachit
Inv.Nr.1.657
4.500 €
 Höchst Porzellan Ziegenmelkerin Modell von Johann Peter Melchior um 1770 Rad-Marke in Unterglasurblau H. 15 cm Sehr guter Erhaltungszustand. (Spitzen der beiden Hörner restauriert.) Vgl.: Kat. Johann Peter Melchior, Gelsenkirchen 1997, Abb. 44.
Höchst Porzellan Ziegenmelkerin Modell von Johann Peter Melchior um 1770 Rad-Marke in Unterglasurblau H. 15 cm Sehr guter Erhaltungszustand. (Spitzen der beiden Hörner restauriert.) Vgl.: Kat. Johann Peter Melchior, Gelsenkirchen 1997, Abb. 44.
Höchst
Porzellan
Ziegenmelkerin
Modell von Johann Peter Melchior
um 1770
Rad-Marke in Unterglasurblau
H. 15 cm
Sehr guter Erhaltungszustand.
(Spitzen der beiden Hörner restauriert.)
Vgl.:
Kat. Johann Peter Melchior, Gelsenkirchen 1997, Abb. 44.
Inv.Nr.0.067
1.250 €
 Meissen Porzellan Cris de St. Petersburg Wasserträgerin um 1755 Modell von Peter Reinicke um 1750 H. 13,5 cm Schwertermarke (Rückseite am Sockel) Basierend auf einer Serie von Stichen nach Zeichnungen von Jean-Baptiste Le Prince, einem Schüler Bouchers
Meissen Porzellan Cris de St. Petersburg Wasserträgerin um 1755 Modell von Peter Reinicke um 1750 H. 13,5 cm Schwertermarke (Rückseite am Sockel) Basierend auf einer Serie von Stichen nach Zeichnungen von Jean-Baptiste Le Prince, einem Schüler Bouchers
Meissen
Porzellan
Cris de St. Petersburg
Wasserträgerin
um 1755
Modell von Peter Reinicke um 1750
H. 13,5 cm
Schwertermarke
(Rückseite am Sockel)
Basierend auf einer Serie von Stichen nach Zeichnungen von Jean-Baptiste Le Prince, einem Schüler Bouchers, der nach Russland reiste, um das Leben und die Sitten der russischen Bevölkerung zu studieren und aufzuzeichnen.
Sehr guter Erhalutngszustand.
Inv.Nr.0.699
1.950 €
 Meißen Porzellan um 1780 « Die zerbrochene Brücke » Modell von Michel Victor Acier um 1777 unterglasurblaue Schwertermarke mit Stern Ausformung um 1780 Michel Victor Acier (Versailles 1736 - Dresden 1799) H. 25,5 cm, L. 17 cm, T. 14 cm Sehr guter Erha
Meißen Porzellan um 1780 « Die zerbrochene Brücke » Modell von Michel Victor Acier um 1777 unterglasurblaue Schwertermarke mit Stern Ausformung um 1780 Michel Victor Acier (Versailles 1736 - Dresden 1799) H. 25,5 cm, L. 17 cm, T. 14 cm Sehr guter Erha
Meißen
Porzellan
um 1780
« Die zerbrochene Brücke »
Modell von Michel Victor Acier um 1777
unterglasurblaue Schwertermarke mit Stern
Ausformung um 1780
Michel Victor Acier (Versailles 1736 - Dresden 1799)
H. 25,5 cm, L. 17 cm, T. 14 cm
Sehr guter Erhaltungszustand
eine kleine Restaurierung an einem Finger und einem Fuß
Inv.Nr.0.706
1.950 €
Kakadu und Ara
Majolika
Nymphenburg
Joseph Wackerle
(1880-1959)
um 1910
H. 57 bzw. 56 cm
Sehr guter Erhaltungszustand
(lediglich die Schwanzfedern des Kakadus am Ende etwas bestoßen)
Vgl.:
Neumeister, München, 29.3.2023, Nr. 65 und 66, mit Reparaturen und Bestoßungen (10.790 €)
Bislang wurde in der Manufaktur Nymphenburg ausschließlich für Innenräume gedachtes Kunstporzellan mit Auf- und Unterglasurbemalung hergestellt. Anfang des 20.Jhts. beschloss man nun figürliche Großplastik sowie Tierplastik in farbig bemalter Majolika herzustellen.
Die in dieser robusten Technik hergestellten Werke boten sich für die Aufstellung in Freiräumen sowie auch als Bauplastik im Außenraum an.
Von Anfang wurde die gesamte Ausführung sowie die Dekoration auf Josef Wackerle zugeschnitten, der 1906 bis 1909 als künstlerischer Leiter der Manufaktur tätig war. In diesen Jahren entstanden auch diese Papageien bzw. Ara, die das 1.Mal auf der Weltausstellung in Brüssel gezeigt wurden.
Hier entwarf Gabriel von Seidl im deutschen Pavillon ein vornehmes Weinrestaurant, in dessen Nischen sich u.a. der "Papagei mit Kirsche", der "Kakadu mit Blumenkorb" sowie der "Ara mit Girlande" befanden. Zur Aufstellung im Botanischen Garten in München modellierte Wackerle noch zusätzlich einen vierten "Papagei mit Maske", den Theodor Körner 1915 in Majolika umsetzte. Neu an dieser Plastik ist die Beigabe von bestimmten Attributen wie die beiden Masken, schwarz und weiß, womit Tragödie und Komödie gemeint ist, sowie die Panflöte, die für Bukolische Musik steht. -
Der botanische Garten war der Modernste seiner Art in Deutschland. Er vereinigt rein streng wissenschaftliche Gesichtspunkte mit der Forderung nach Ästhetik. So bilden die vier Vogelplastiken von Wackerle die Eckpunkte des Schmuckhofes, der einen besonderen Ziergarten mit Zu- und Abgang darstellt.
Wackerle orientierte sich gerne an der figürlichen Meißener Vogelplastik des 18.Jhts., sein Vorbild war z. B. der kompositionsgleiche Papagei auf Blumenkorb von Kaendler. Seine Papageien-Serie wurde in zwei unterschiedlichen Größen hergestellt (I und II), einmal für die öffentliche Präsentation, dann aber auch in der kleineren Ausführung für private Gärten. Um Ausformungen der letzten Art handelt es sich bei diesem Paar.
Inv.Nr.1.002
VERKAUFT
Hugo Meisel
(1887-1966)
Großplastik
„Fisch auf Wellen“
Figur der Ausstattung des Leipziger "Porzellan Palais"
anläßlich der Frühjahrsmesse 1921
Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur
um 1920
polychrome Aufglasurmalerei
Rückseite unten eingeritztes Monogramm HM, darunter unterglasurblaue Manufakturmarke
Höhe: 78,5 cm
Bei dem angebotenen Fisch handelt es sich um eines der fünf bekannten Exemplare aus dem Leipziger "Porzellan Palais", die um 1920 gefertigt wurden:
Eine unbemalte Ausformung gehört zu den Beständen des Hetjens-Museums, eine weitere, ebenfalls unbemalte, im Grassimuseum, Leipzig, die dritte in Privatbesitz.
Lt. Dr. Christoph Fritzsche ist die hier angebotene Plastik die einzige, original staffierte, noch existierende Ausformung. Ein weiteres, bemaltes Exemplar ist Kriegsverlust.
Wir danken Herrn Dr. Fritzsche für die Hinweise.
Die Volkstedter Manufaktur erlebte um Anfang des 20. Jh. einen wirtschaftlichen und künstlerischen Aufschwung. 1921 wurde als erstes Branchenmessehaus der Leipziger Messe das ehemalige Königliche
Palais für die Präsentation der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur sowie für ihre Zweigbetriebe und anderen Firmen u. a. Hutschenreuther umgebaut und eingerichtet. Der Berliner Architekt Hans
Poelzig und seine spätere Frau Marlene Moeschke wurden mit dem Entwurf der Innenausstattung beauftragt. Diesem stilistischen Rahmen einfügend schufen Hugo Meisel und Arthur Storch eine Serie von
mindestens 16 großformatigen Tierplastiken, die die Räume des "Porzellan Palais" expressiv zierten.
Die Großplastiken aus der Zeit um 1920, die in der Aeltesten Volkstedter Porzellanfabrik AG ausgeformt wurden, bilden einen Höhepunkt im Schaffen des Thüringer Porzellankünstlers Hugo Meisel. Zusammen mit Arthur Storch (1870-1947) erhielt Hugo Meisel 1921 für die Mitarbeit bei der Ausgestaltung des Messehauses "Porzellan-Palais" Leipzig große Anerkennung. Beide Künstler schufen zu diesem Zweck zwischen 1919 und 1921 um die 20 Modelle an phantasievollen Großplastiken, wie sie bisher nur aus der Meißner Kändler-Zeit bekannt waren. Weiterhin entwarfen die Innenarchitekten Prof. Hans Poelzig (1869-1936) und Gustav Partz (1883-1957) verschiedene, bis zu 2,50 m hohe Beleuchtungskörper aus Porzellan, die ebenfalls die Räume des Palais schmückten. Dem 1921 veröffentlichten Presseartikel nach zu urteilen war dieses Messehaus mit den Porzellanen aus Thüringen die Sensation, so heißt es "... strahlt das Treppenhaus in hellen Farben, belebt durch große künstlerische Porzellan-Tierfiguren und Kandelaber, Erzeugnisse der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur ...".
So große Porzellanplastiken hatte es seit den barocken Meissener Tierfiguren von Johann Gottlieb Kirchner und Kaendler nicht mehr gegeben. Diese Figur gehört zu einer Serie von 16 Tieren und Fabelwesen nach Modellen von Hugo Meisel und Arthur Storch, welche in Kombination mit expressiv anmutenden Konsolen und stattlichen Beleuchtungskörpern aus Porzellan (nach Entwürfen der Architekten Hans Poelzig und Gustav Partz) im legendären Leipziger Porzellan-Palais wirkungsvoll in Szene gesetzt wurden. Diesen Ort nahmen die Besucher ab der Frühjahrsmesse 1921 als eine besondere Attraktion wahr. Gingen bis dahin im Messe-Wirrwarr gute Waren oft unter – ein Ärgernis, welches im übrigen auch die Gründung der Grassimesse beförderte –, so präsentierten sich nun Porzellanhersteller spezifisch in einem Branchenmessehaus.
Die Volkstedter Großplastiken, teils in Weißporzellan, teils farbig bemalt, kündeten durch ihre Monumentalität und ihre Mischung aus Stilisierung und Naturnähe von dem Willen, mit dem Material Porzellan neue Wege zu beschreiten. Im Schaffen ihrer Entwerfer absolute Höhepunkte, wurden vermutlich dennoch kaum zehn Ausformungen pro Modell ausgeführt.
Inv.Nr.7.504
VERKAUFT
 Meissen Cris de Paris Porzellan um 1760 Traubenverkäufer Modell von Peter Reinicke Schwerter-Marke (auf der Rückseite) H. 14,5 cm
Meissen Cris de Paris Porzellan um 1760 Traubenverkäufer Modell von Peter Reinicke Schwerter-Marke (auf der Rückseite) H. 14,5 cm
Meissen
Cris de Paris
Porzellan
um 1760
Traubenverkäufer
Modell von Peter Reinicke
Schwerter-Marke
(auf der Rückseite)
H. 14,5 cm
Sehr feine, frühe Ausformung im hervorragenden Erhaltungszustand (minimale Chips)
Inv.Nr.0.603
VERKAUFT
 Scaramouche Commedia dell´arte aus der sogenannten Weißenfels-Serie Meißen das Modell von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke April 1744, die Ausformung zeitnah. H. 13,3 cm
Scaramouche Commedia dell´arte aus der sogenannten Weißenfels-Serie Meißen das Modell von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke April 1744, die Ausformung zeitnah. H. 13,3 cm
Scaramouche
Commedia dell´arte
aus der sogenannten Weißenfels-Serie
Meißen
das Modell von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke April 1744, die Ausformung zeitnah.
H. 13,3 cm
Sehr schöner Erhaltungszustand.
Der Auftraggeber für eine Reihe von Figuren dieses Themas war Johann Adolf II. Herzog von Sachsen Weißenfels (1685 - 1745), von Kaendler
als "Ihro Durchl. dem Hertzog Von Weißen Fels" bezeichnet.
Der frankophile Fürst entschloss sich schon früh für die militärische Laufbahn. Sein Vetter August II. König von Sachsen berief ihn 1711 in sächsisch-polnische Dienste. Nach dessen Tod 1733 half er
dem Nachfolger, König August III., die polnische Königswürde zu sichern, was ihm durch den Sieg über Stanislaus I. Leszczynski 1736 gelang. Die Figurengruppen wurden zwischen dem Ersten und Zweiten
Schlesischen Krieg, an deren Durchführungen er maßgeblich beteiligt war, in Meißen geordert und ausgeführt. Für die bildhauerische Leistung der Manufaktur stellten sie einen spektakulären Erfolg dar,
denn sie entstanden als dreidimensionale Plastiken nur teilweise nach bzw. inspiriert von Stichfolgen. Vieles war also Eigenleistung der Modelleure, wie in diesem Fall Peter Reinicke und Johann
Joachim Kaendler.
Inv.Nr.0.755
VERKAUFT
 HOCHBEDEUTENDE KAMINUHR "TRIUMPH DER LUST ÜBER DIE VERNUNFT" MEISSEN UM 1765 Johann Joachim Kaendler
HOCHBEDEUTENDE KAMINUHR "TRIUMPH DER LUST ÜBER DIE VERNUNFT" MEISSEN UM 1765 Johann Joachim Kaendler
HOCHBEDEUTENDE
KAMINUHR
"TRIUMPH DER LUST ÜBER DIE VERNUNFT"
MEISSEN
UM 1765
in Gestalt eines Denkmals
das Porzellanpostament bekrönt von einer Bacchus-Gruppe
auf den vier Ecken Putten als Allegorien auf die Wissenschaften
Modelle von Johann Joachim Kändler
Eingefaßt von einer Porzellangalerie
feuervergoldete Bronzemontierung mit Widderköpfen und Girlanden
Schwerter-Marke
H. 60 cm
Einziges, bisher bekanntes Exemplar
VERKAUFT
_______________________________________
 Schäferpaar Schäfer und Schäferin sitzend Meissen Johann Joachim Kaendler um 1750 H. 17 cm bzw. 16 cm Sehr schöner Erhaltungszustand Inv.Nr.0.443 1.950 €
Schäferpaar Schäfer und Schäferin sitzend Meissen Johann Joachim Kaendler um 1750 H. 17 cm bzw. 16 cm Sehr schöner Erhaltungszustand Inv.Nr.0.443 1.950 €
Schäferpaar
Schäfer und Schäferin
sitzend
Meissen
Johann Joachim Kaendler
um 1750
H. 17 cm bzw. 16 cm
Sehr schöner Erhaltungszustand
Inv.Nr.0.443
VERKAUFT
 Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg 1869 Alexander II. August Spiess Der Wasserträger Biskuit Porzellan H. 58 cm Signiert und datiert Spiess 1869 Russian Imperial porcelain factory
Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg 1869 Alexander II. August Spiess Der Wasserträger Biskuit Porzellan H. 58 cm Signiert und datiert Spiess 1869 Russian Imperial porcelain factory
Rußland
Kaiserliche Porzellanmanufaktur
St. Petersburg
1869
Alexander II.
August Spiess
Der Wasserträger
Biskuitporzellan
H. 58 cm
Signiert und datiert
Spiess 1869
sowie auf der Sockelunterseite bezeichnet
Russian Imperial Porcelain Factory
St. Petersburg
The watercarrier
signed and dated
Spiess 1869
Inv.Nr.0.286
VERKAUFT
___________________________________________________
HÖCHST
UM 1770
SATZ VON VIER KINDERN
JOHANN PETER MELCHIOR
PORZELLAN
Rad-Marke
Faßbauer: Hammeroberteil rest.
Schmied: Eisen auf Amboß rest.
Junge mit Krug: Krugrand rest.
Mädchen mit Krug: Henkel rest., an den Füßen geklebt
PROVENIENZ:
Bedeutende nordeuropäische Sammlung
VERKAUFT
_________________________________
 KAISERLICHE PORZELLAN MANUFAKTUR ST.PETERSBURG RUSSLAND Porzellan ALEXANDER II. 1876 A. SPIESS - Imperial porcelain factory
KAISERLICHE PORZELLAN MANUFAKTUR ST.PETERSBURG RUSSLAND Porzellan ALEXANDER II. 1876 A. SPIESS - Imperial porcelain factory
KAISERLICHE PORZELLANMANUFAKTUR
ST.PETERSBURG
ALEXANDER II.
1876
ANTIKISIERENDE WEIBLICHE FIGUR MIT KANNE
Modell von August Spiess
Signiert und datiert A. Spiess 1876
H. 62 cm
Einziges, bisher bekanntes Exemplar
Siehe E. Khmelnitskaya, Die plastischen Figuren von August Spiess, St.Petersburg 2008
VERKAUFT
__________________________________________
NONNE
UM 1745
MEISSEN
MODELL
JOHANN JOACHIM KAENDLER
Schwerter-Marke auf der Unterseite
vgl.
Rückert, Nr.976
Dort fast identisches Exemplar des Bayerischen Nationalmuseums München
Taxa Kaendler 1740-1748:
„1 Nonne auf einem Felsen sizend und betend mit beyden Händen ein Buch haltend, vor die Aebtißin von Herfordt, 3 Thlr.“
VERKAUFT
__________________________________
MEISSEN
1763-1774
Michel Victor Acier
(* 20. Januar 1736 in Versailles bei Paris; † 16. Februar 1799 in Dresden)
und
Johann Carl Schönheit
(* Februar 1730 in Meißen; † 27. Mai 1805 ebenda)
LIEBESPAAR
Allegorie Frühling
Marke mit Punkt in Unterglasurblau
H. ca. 20 cm
Hervorragender Erhaltungszustand
(minimalste Bestoßungen an den Blüten und Blättern)
VERKAUFT
______________________________________
SEHR
SELTENE
UND
ÄUSSERST FEIN
STAFFIERTE
FIGUR
EINES
CHINESEN
RUSSLAND
KORNILOV
PORZELLANMANUFAKTUR
1835-1843
eingepreßte Marke
H. 21,5 cm
Sehr guter Erhaltungszustand
VERKAUFT
-------------------------------------------------------------------
FRANKENTHAL
1783
Kindergruppe mit Hund
Johann Peter Melchior
Unterglasurblaue CT-Marke
H. 18 cm
PROVENIENZ:
Familie Rothschild
Swinton Grange, North Yorkshire
Sehr guter Erhaltungszustand
(minimale Bestoßungen)
VERKAUFT
_____________________________________
ANTJE BRÜGGEMANN-BRECKWOLDT
TELLER
mit Messer, Tuch und Granatapfel
1985
31 x 26 cm
AUSSTELLUNG:
"Material und Form"
Paris/Mainz
1985
Kat.-Nr. 26
PROVENIENZ:
Bedeutende deutsche Privatsammlung
ANTJE BRÜGGEMANN-BRECKWOLDT
1941 in Bützow/Mecklenburg geboren; 1961 Abitur; 1961-63 Töpferlehre bei Helma Klett, Fredelsloh, Gesellenprüfung; 1963-65 Studium an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei Prof. Jan Bontjes van Beek; 1965-66 Studium an der Hochschule für Bildende Künste Kassel, Keramik bei Walter Popp; 1966-69 Werkstatt in Westerland / Sylt; seit 1969 verheiratet mit Volker Brüggemann; 1969-70 Fortsetzung des Studiums in Kassel; 1970-75 Werkstatt in Bad Hersfeld; seit 1975 Werkstatt in Wippershain; seit 1979 Mitglied der AIC, Genf
1969 1. Preis Richard-Bampi-Wettbewerb; 1975 Preis der Justus Brinckmann Gesellschaft, Hamburg; 1976 Staatspreis Hamburg; seit 1979 Mitglied der AIC; seit 1983 Mitglied der Gruppe 83; 1985 Westerwaldpreis für Keramik, Preis für "Aufgebautes keramisches Gefäß"; 1992 Preis der 1. Int. Triennale für Keramik, Kairo; 1997 Entwurf für British Airways und die Deutsche BA
675 €
____________________________________
Würzburg
1775-1780
Putto mit Frosch
Höhe 7,4 cm
Putto mit Lamm
Höhe 7,5 cm
Provenienz:
Putto mit Lamm - The Ernesto F. Blohm Collection, Christie's, London, 10.4.1989, lot 51(Zuschlag 7.150 GBP = ca. 10.500 €);
beide - Sammlung Neuhaus, Neumeister, München,
22.Mai 1996, Nrn. 36 und 37
Literatur:
Putto mit Frosch - H.P. Trenschel & L. Wamser, Würzburger Porzellan, Würzburg, 1986, Nr. 73, Abb. 82, S.229
Ausstellung:
Putto mit Frosch - Würzburger Porzellan, Mainfränkisches Museum Würzburg, 11.10.-14.12.1986, Kat-Nr. 73
VERKAUFT
--------------------------------------------------------------
SELTENES REISESERVICE MIT FEINER BLUMENMALEREI
Ludwigsburg
um 1760-1765
Bemalung Johann Eberhard Stenglein (1760-1765 in Ludwigsburg tätig).
Jede Form mit feinster Blumenmalerei und feinen Goldspitzenbordüren an den Rändern und Kanten. Bestehend aus: 1 Teekanne und Deckel, 1 Zuckerdose und Deckel, 1 Cremier, 2 kleine Wasserflakons und 1 großer Wasserflakon und ein Parfum Flakon, jeweils mit vergoldeter Silbermontierung.
Kurhut über CC-Monogramm in Unterglasurblau
Ritzzeichen
Alle Teile: ST Malermarken in Eisenrot.
Provenienz: Deutsche Privatsammlung.
Johann Eberhard Stenglein sowie sein Sohn Leonhardt Gottfried Stenglein sind in der Ludwigsburger Porzellanmanufaktur zwischen 1760-1765, bzw. bis 1787 als Porzellanmaler bestätigt. Hans Dieter Flach hat 2005 eine Reihe von einfacheren Blumenmalereien auf ST gemarkten Porzellanen als Werk Stengleins identifiziert. (Dieter Flach, Malerei auf Ludwigsburger Porzellan, 2005, S. 42 u. S. 226). Mit den vorliegenden 'ST' gemarkten Stücken kann man die Reihe von Stenglein bemalten Porzellanen mit diesen feinen Blumenmalereien erweitern. Zu einer Diskussion über diesen Typus feiner Malerei, bisher Gottlieb Friedrich Riedel zugeschrieben, vgl. Flach, Blumenmalereien von Joseph Jakob Ringler und Gottlieb Riedel auf Ludwigsburger Porzellan, Keramos 202/2008, S. 31-38.
Die seltenen Flakonformen wurden in der Literatur meist als Teebüchse bezeichnet. Reinhard Jansen hat auf diese Sonderform hingewiesen und den Unterschied der beiden Formen erläutert. Zu dem Schraubverschluss der Flakons gehöre ein Korkstopfen, der dazu diente, den Flakon wasserdicht abzuschließen. Die Flakons waren also dazu bestimmt, Flüssigkeit aufzunehmen, um während der Reise vermutlich das Wasser für den Tee mitführen zu können (Jansen, Glanz des Rokoko. Ludwigsburger Porzellan aus der Sammlung Jansen, 2008, S. 314.)
VERKAUFT
--------------------------------------------------------------
 KPM VASE KÖNIGLICHE PRUNK PORZELLAN BERLIN 1849-1870 SCHLOSS BABELSBERG WILHELMSPALAIS GESCHENK KÖNIG FRIEDRICH WILHELM IV. VON PREUSSEN
KPM VASE KÖNIGLICHE PRUNK PORZELLAN BERLIN 1849-1870 SCHLOSS BABELSBERG WILHELMSPALAIS GESCHENK KÖNIG FRIEDRICH WILHELM IV. VON PREUSSEN
GROSSE
KÖNIGLICHE
PRUNKVASE
„FRANZÖSISCHE FORM MIT GREIFENKOPFHENKELN“
KPM BERLIN
1849-1870
MIT
TOPOGRAHISCHEN ANSICHTEN
SCHLOSS BABELSBERG
WILHELMSPALAIS
Höhe 70 cm
PROVENIENZ:
Italienisches Adelshaus;
Geschenk des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen
Marken:
Zepter und Pfennigs-Marke in Unterglasurblau, Reichsapfel und KPM in Braun
Beide Reserven jeweils versehen mit der Königskrone
(nur die Geschenkvasen bzw. Vasen für den König trugen die Königskrone)
Die Vase wird geliefert mit einem schwarzen Holzpodest mit goldener Aufschrift:
Auf dem Sockel ist in Italienisch vermerkt, daß es sich um ein Geschenk des preußischen Königs handelt
Aktuell wurden zwei ähnliche Vasen, jedoch ohne Königliche Provenienz, versteigert bei Christie´s, London, 2.-3.Juni 2015, Nr. 86, 17.500 GBP = 24.500 EURO, bzw. 2.Juni 2015, Nr. 273, 15.000 GBP = 20.750 EURO (kleinere Vase)
VERKAUFT